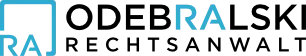Es kann passieren, ohne dass man damit rechnet. Es reicht, dass die eigenen Kontaktdaten oder sogar ein Chat im Telefon der verdächtigen Person gefunden werden, und schon rückt man selbst in den Fokus der Ermittlungen.
Problematisch wird dies vor allem, wenn es in den besagten Chats um Geschäfte mit Betäubungsmitteln geht.
Chats als Beweis im Strafverfahren
Grundsätzlich können solche Chats nämlich als Beweis im Strafverfahren angeführt werden. Jedoch verliert ein solcher Nachrichtenverlauf an Beweiskraft, wenn beispielsweise Codewörter für eine bestimmte Droge verwendet wurden. Zudem kann man anhand eines Chats lediglich beweisen, dass der Betroffene beispielsweise Kontakt zu dem Dealer aufgenommen hat – ob sich die beiden Parteien jedoch auch tatsächlich getroffen haben und ob es dabei sogar zu einer Übergabe gekommen ist, lässt sich anhand der Chats oftmals nicht beweisen.
Auf der anderen Seite gewinnen die Chats wiederum an Beweiskraft, je mehr Material noch gegen den Betroffenen vorliegt. Zieht sich der Chatverlauf über einen langen Zeitraum hinweg und tauchen in diesem immer wieder ähnlich klingende Nachrichten oder dieselben Codewörter auf, so spricht dies auch gegen den Betroffenen.
Was darf und kann die Polizei tun?
Es ist zudem wichtig zu wissen, was die Ermittler in einem solchen Fall für Handlungsmöglichkeiten haben.
Zwar können die meisten Chats als Beweismittel vor deutschen Gerichten dienen, jedoch können Nachrichten meist nicht mitgelesen werden.
So zum Beispiel bei WhatsApp-Nachrichten. Grund dafür ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des Messenger Dienstes. Das bedeutet, dass eine Nachricht, sobald sie das Gerät des Absenders verlässt, verschlüsselt wird. Erst auf dem Gerät des Empfängers wird diese Nachricht dann entschlüsselt.
Die Polizei kann diese Nachrichten jedoch lesen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Dabei wird zwischen offenem und heimlichem Vorgehen unterschieden.
Bei dem offenen Vorgehen wird beispielsweise das Handy beschlagnahmt, wenn vermutet wird, dass sich darauf Beweismittel befinden könnten. Die Polizei versucht dann, den Speicher des Handys auszulesen oder den Code zu knacken.
Auf der anderen Seite wird beim heimlichen Vorgehen das Handy nicht beschlagnahmt, sondern die Polizei greift eben heimlich auf das Handy zu, ohne dass die betroffene Person davon weiß. Nötig ist dafür ein bestimmtes Programm, welches durch einen verdeckten Ermittler oder durch „hacking“ auf das Handy geladen wird.
Innerhalb des heimlichen Vorgehens wird weiter zwischen zwei verschiedenen Varianten unterschieden.
Die erste Variante ist die sogenannte „Quellen-Telekommunikationsüberwachung“ – kurz „Q-TKÜ“, welche in §100a der Strafprozessordnung (StPO) geregelt ist. Diese darf nur unter strengen Voraussetzungen durchgeführt werden. Es braucht konkrete Anhaltspunkte dafür, die auf die Person als Täter einer schweren Straftat wie Raub, Mord aber auch den Handel mit Betäubungsmitteln, hinweisen. Zudem darf die Überwachung nur erfolgen, wenn die Aufklärung des Sachverhalts ohne diese Maßnahme erheblich erschwert werden würde.
Im Rahmen der Q-TKÜ werden bestimmte Daten wie Telefongespräche oder SMS an durch den Telekommunikationsanbieter an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Ebenso erhält die Polizei Informationen über die verwendete IMEI-Nummer (eindeutige Gerätekennzeichung) sowie über die Funkzelle, in der das Gerät registriert ist.
Bei der zweiten Variante handelte es sich um die sogenannte „Online-Durchsuchung“, welche in §100b der StPO geregelt ist. Im Gegensatz zur Q-TÜK geht diese Maßnahme noch einen Schritt weiter, weshalb auch das Gesetz höhere Anforderungen an die Online-Durchsuchung stellt. Hierbei werden nicht nur die laufende Telekommunikation überwacht, sondern die Ermittlungsbehörden erhalten Zugriff auf sämtliche gespeicherte Daten des Handys oder Computers.
Technisch umgesetzt wird die Online-Durchsuchung meist durch den Einsatz von spezieller Spionagesoftware, umgangssprachlich „Bundestrojaner“ genannt. In der Praxis kommt dieses Instrument jedoch bislang nur selten zum Einsatz. Hauptsächlich wird es vom Bundeskriminalamt (BKA) im Bereich der Terrorismusbekämpfung verwendet. Doch selbst in diesem Bereich zeigt man Zurückhaltung. So wurde beispielsweise im Jahr 2019 selbst in den 550 eingeleiteten Terrorismusverfahren keine Online-Durchsuchung beantragt. Grund dafür ist vor allem der enorme technische und juristische Aufwand.
Quellen: anwalt.de, bbr.legal