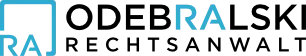Am 1. April 2024 ist Cannabis teillegalisiert worden. Für die Konsumenten ein eindeutiger Gewinn, für die Justiz jedoch eine große Aufgabe. Die Bewältigung der Amnestie-Regelung für Cannabis-Altfälle. Eine wiederholte Ansicht von Altfällen in großem Stil fällt an.
Was besagt die Amnestie-Regel?
Nach der Amnestie-Regel müssen alle Strafen für Cannabis-Vergehen, die bis zum 1. April 2024 noch nicht vollständig vollstreckt wurden, erlassen werden, wenn die Tat nach neuem Recht legal ist. Wer also beispielsweise aktuell für den Besitz von weniger als 25 Gramm Cannabis Gefängnis sitzt, müsste freigelassen werden.
Dies stellt die Justiz vor eine große Aufgabe. Sie muss viele bereits abgeschlossene Verfahren prüfen und anpassen, insbesondere sogenannte Mischfälle.
Diese Amnestie-Regelung ist bei Gesetzesänderungen üblich. Das neue Cannabisgesetz verweist lediglich auf die anzuwendende Norm. Diese lautet folgendermaßen:
Art. 313 Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch – Noch nicht vollstreckte Strafen
(1) Rechtskräftig verhängte Strafen wegen solcher Taten, die nach neuem Recht nicht mehr strafbar und auch nicht mit Geldbuße bedroht sind, werden mit Inkrafttreten des neuen Rechts erlassen, soweit sie noch nicht vollstreckt sind. (…)
Eine besondere Herausforderung: Mischfälle
Eine besonders große Herausforderung stellen Mischfälle dar, also Fälle, bei denen Cannabis-Besitz zusammen mit anderen Delikten verurteilt wurde. Diese sind besonders aufwändig, denn hier muss im Einzelfall eine neue Strafe festgesetzt werden. Es gibt dabei Mischfälle, bei denen die Person tatmehrheitlich (§53) mehrere Tatbestände erfüllt hat und das Gericht deswegen eine Gesamtstrafe bildet. Jedoch gibt es auch solche Mischfälle, in denen die Person ein oder mehrere Tatbestände tateinheitlich (§52) erfüllt hat. Ein solcher Mischfall liegt beispielsweise vor, wenn man bei dem Täter nicht nur Cannabis, sondern auch noch Kokain findet.
Amnestie war bereits bei Gesetzesplanung Kritikpunkt
Innerhalb der damaligen Planung des Cannabisgesetzes galt die geplante Amnesie bereits als einer der Hauptkritikpunkte der Justiz. Justiz und Vollstreckungsbehörden hatten einen hohen bürokratischen Aufwand und die Vielzahl der Altfälle betont, die erneut bearbeitet werden müssten. Richter- und Staatsanwaltschaftsvereinigungen hatten vor allem im Bundesrat bis zuletzt versucht, Gehör zu finden. Doch trotz dieser geäußerten Bedenken trat die erste Stufe des Cannabisgesetztes, das KCanG samt Amnestie-Regelung in Kraft.
So ergab sich das erste Problem recht schnell: die betroffenen Altfälle mussten identifiziert werden. Es mussten also zunächst die Akten gesichtet werden. Um sich diesen Schritt zu erleichtern, haben Rechtspfleger in Berlin in enger Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung und den Dezernaten ein System entwickelt.
“Unsere IT-Abteilung hat eigens ein Abfrage-Modul entwickelt, um die Fälle zu finden”, berichtet Anke Bittig von der Berliner Staatsanwaltschaft. Trivial sei das nicht gewesen, das Aktenverwaltungssystem der Berliner Staatsanwaltschaft kam an seine Grenzen. “Das Modul musste immer wieder angepasst und optimiert werden. Zuerst haben wir nach Stichworten im Text der Eingangserfassung der Akte gesucht, aber das hat sich nicht bewährt. Da war zum Beispiel laut Akte ein Fall von § 30 BtMG, der aber dann doch nach § 29 BtMG verurteilt wurde.” Später habe man sich darauf verlegt, die Mitteilungen an das Bundeszentralregister zu durchsuchen. “Man kann nie ausschließen, dass wir einen Fall übersehen haben. Wir sind nicht perfekt. Und es gab keine Zeit oder Möglichkeit, sich auf solch eine Abfrage vorzubereiten.”
Eine Bewältigung des Problems mithilfe von Technologie: ein Vorgehen, das bundesweit wohl nur ein „Pionier“ ist. Die Digitalisierung findet – so scheint es, ihren Weg in die Justiz nur langsam. Auch der Datenschutz ist ein Grund für dieses schleppende Vorangehen der Digitalisierung. Undurchsichtige Datenbestände sind Folge der “Verpflichtung staatlicher Stellen, Daten nur in dem begrenzten Umfang zu speichern”, so das hessische Justizministerium. Häufig lässt sich bei den Datenbeständen der Staatsanwaltschaften nur herauslesen, ob es sich bei einem Fall um ein Rauschgiftdelikt handelt, nicht aber, welche Droge dabei eine Rolle spielte.
Unter anderem in Bayern und Dresden erfolgt die Sichtung der Akten daher noch „in Handarbeit“.
Zweites Problem: Personalmangel. Nicht nur die fehlende Digitalisierung erweist sich als großes Problem innerhalb des Mehraufwands der Justiz, sondern ebenso ein erheblicher Personalmangel. Auch bezüglich dieses Punktes wird deutliche Kritik am Gesetzgeber geäußert. Man hätte sich eine Übergangsfrist gewünscht, in der die Justiz ohne Zeitdruck die nötigen Vorbereitungen hätte treffen können. Doch der Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden.
Auch Anke Bittig von der Berliner Staatsanwaltschaft stellt noch einmal fest: “Wir waren recht sportlich und die Gerichte haben auch gut mitgemacht. Trotzdem bin ich froh, dass das eine einmalige Sache war.”
Quellen: beck-online.beck.de, zdf.de