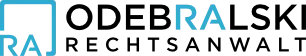Unter dem Deckmantel seiner ärztlichen Zulassung verordnete ein Arzt aus München in der Zeit von März 2017 bis Juli 2018 Cannabisprodukte, ohne dass es dafür einen medizinischen Grund gab bzw. ohne seine Patienten:innen vorher zu untersuchen. Der Münchener rechnete dies aber nicht nach der Gebührenordnung für Ärzte ab, sondern verlangte Barzahlungen für die Rezepte in Höhe von 150 Euro für eine Erstverschreibung und 60 Euro für ein Folgerezept. Dabei vereinnahmte er mindestens 48.300 Euro. Die hierzu angemieteten Praxisräume seien jedoch für ,, eine Untersuchung und ordnungsgemäße Diagnosestellung ‘’ gar nicht ausgestattet gewesen. Nicht einmal eine Liege habe es gegeben, so der Anwalt des Angeklagten. Stattdessen traf der Mediziner seine ,,Patienten’’ in verschiedenen Örtlichkeiten in München. Einmal reservierte er beispielsweise einen Tisch in einem Restaurant und tauschte dort ein Privatrezept gegen Barzahlung. Auch auf Cannabis-Messen trat der Mann als Arzt auf und lockte so neue Kunden. Auf die Idee war der Arzt mit dem Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 6. März 2017 gekommen. Diese erlaubt nämlich das Verschreiben von Cannabis, wenn eine Untersuchung ergibt, dass die Medikation des Mittels aus ärztlicher Sicht geeignet und erforderlich ist.
Deswegen hatte das Landgericht München den Mann wegen des unerlaubten Verschreibens von Betäubungsmitteln entgegen § 13 Abs.1 BtMG in 539 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Landgericht hat seine Taten jeweils als ,,gewerbsmäßiges’’ Verschreiben von Betäubungsmitteln im Sinne des § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6a BtMG beurteilt und in Hinblick auf Strafrahmen des § 29 Abs. 3 Satz 1 BtMG gegen den Angeklagten Einzelfreiheitsstrafen von je einem Jahr und zwei Monaten verhängt.
Der erste Strafsenat des BGH hat die Revision des Angeklagten nach einer Beschränkung des Verfahrens und einer Teilaufhebung einiger Rechtsfolgen als unbegründet verworfen. So hob der Erste Strafsenat das im Urteil verhängte Berufsverbot von drei Jahren auf. Allein die Anzahl der abgeurteilten Taten würde eine Wiederholungsgefahr nicht begründen. Schlussendlich wurde noch die Summe gesenkt, die der 69-Jährige erwirtschaftet haben soll. Nach BGH-Angaben werden statt 47.700 Euro nur noch 43.110 Euro als Taterträge eingezogen. Die Haftstrafe ist nun rechtskräftig.
Quellen: BGH, Beschl. v. 20.März 2023 – 1 StR 266/22 – juris, lto.de