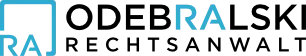Ein Mensch begeht eine Straftat und wird auch verurteilt – doch anstatt ins Gefängnis zu müssen, darf er nach Verkündung des Urteils den Gerichtssaal verlassen und nach Hause gehen. Das klingt erst einmal ungerecht. Doch hinter der sogenannten „Bewährungsstrafe“, die so etwas ermöglicht, steckt mehr als nur Milde. Sie stellt eines der wichtigsten Instrumente des deutschen Strafrechts dar.
Durch die Bewährungsstrafe muss eine Freiheitsstrafe nicht sofort vollstreckt werden, so dass dem Verurteilten unter bestimmten Bedingungen ein straffreies Leben ermöglicht wird. Doch wie sinnvoll ist diese zweite Chance wirklich und unter welchen Voraussetzungen steht sie? Wir werfen einen Blick auf das oftmals missverstandene Rechtsinstitut.
Die Voraussetzungen
Wirft man einen Blick in das Strafgesetzbuch (StGB) so stößt man auf die Regelungen zur Bewährungsstrafe nach §§56-58 StGB. Darin bestimmt das Gesetz, dass eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Täter auch ohne Strafvollzug künftig straffrei bleibt.
Das Gericht kann eine Strafe also zur Bewährung aussetzen, wenn die verhängte Strafe zwei Jahre nicht überschreitet. Zusätzlich muss eine positive Sozialprognose gestellt werden können und es dürfen keine schwerwiegenden Gründe gegen eine Aussetzung sprechen, wie zum Beispiel bei einem Täter, der hoch rückfallgefährdet ist.
Bei der Sozialprognose berücksichtigt das Gericht verschiedene Faktoren. Dabei spielen insbesondere die persönlichen Umstände des Täters, wie etwa die Persönlichkeit, das bisherige Leben, die aktuellen Lebensverhältnisse und das Verhalten nach der Tat eine große Rolle. Positiv wirkt es sich aus, wenn der Täter eine feste Arbeitsstelle, eine gesicherte Wohnsituation und stabile soziale Bindungen hat.
Insbesondere werden bestehende Vorstrafen berücksichtigt. Dabei guckt das Gericht vor allem auf die Rückfallgeschwindigkeit – je schneller nach einer Verurteilung neue Straftaten begangen werden, desto schlechter fällt die Sozialprognose aus.
Die Aussetzung der Freiheitstrafe zur Bewährung kommt also insbesondere in Betracht, wenn es sich um einen Ersttätern mit einer positiven Einschätzung der künftigen Entwicklung handelt.
Die „Regeln“ der Bewährung
Die Bewährungszeit, die das Gericht bestimmt, darf nicht unter zwei Jahren und nicht über fünf Jahren liegen. Innerhalb dieser Zeit kann das Gericht dem Verurteilten bestimmte Auflagen oder Weisungen auferlegen.
Auflagen (§56b) dienen der Genugtuung des begangenen Unrechts. So kann das Gericht beispielsweise anordnen, dass der Täter einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen hat oder gemeinnützige Leistungen erbringen muss. Neben Bewährungsauflagen können dem Verurteilten auch Weisungen (§56c) auferlegt werden. Dazu gehört z.B. die Anweisung eine Therapie wahrzunehmen oder die Pflicht, sich zu bestimmten Zweiten bei Gericht oder einer anderen Stelle zu melden.
Wird gegen die Bewährungsauflagen verstoßen oder begeht der Verurteilte sogar erneut eine Straftat, kann das Gericht die Bewährung nach §56f StGB widerrufen. Dabei können auch „kleine“ Straftaten, wie zum Beispiel Schwarzfahren, dazu führen, dass ein Bewährungswiderruf erfolgt. Kommt es zu einem solchen Widerruf, dann muss die ursprünglich ausgesetzte Strafe vollstreckt werden.
Ziele und Zwecke
Wie bereits oben kurz erwähnt, soll die Aussetzung einer Strafe zur Bewährung dem Verurteilten die Chance auf ein straffreies Leben geben. Die Bewährungsstrafe verfolgt damit primär den Zweck der Resozialisierung und soll zudem das Strafvollzugssystem entlasten. Sie spart auch erhebliche Kosten, die mit einem Strafvollzug verbunden sind.
Der Täter soll die Verurteilung als einen „Warnschuss“ verstehen und durch eine zweite Chance motiviert werden, sein Verhalten in der Zukunft zu ändern, ohne die negativen Folgen einer Haftstrafe. Denn ein solcher Gefängnisaufenthalt kann zu einschneidenden Folgen, sowohl im beruflichen Leben als auch im sozialen Umfeld führen, beispielsweise der Verlust des Arbeitsplatzes oder dass sich Freunde und Familie abwenden.
Die Bewährungsstrafe ist damit mehr als eine bloße Alternative zur Gefängnisstrafe – sie ist ein Angebot zur Veränderung. Wer sie erhält, steht vor der Chance zu zeigen, dass Strafe auch ohne Gefängnismauern wirkt.
Quelle: www.kupka-stillfried.de, rechtsanawalt-in-hannover.de, strafrechtsiegen.de, kujus-strafverteidigung.de, BVerfG 2 BvR 2059/03