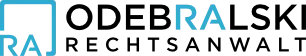Ein positiver Test ohne gekifft zu haben? Das geht! Wir erklären, warum und was das für Probleme mit sich bringt.
Am 1. April 2024 ist die Teil-Legalisierung von Cannabis in Kraft getreten. Doch die Legalisierung wirft viele Fragen in der Praxis auf. Vor dem 1. April war es dem Gesetzgeber unter anderem zeitlich nicht mehr möglich, den Grenzwert für die Teilnahme am Straßenverkehr festzusetzen. Nach einem Bericht der „Augsburger Allgemeinen“ liegt aber bereits ein erster Gesetzesentwurf vor. Wer mit 3,5 Nanogramm THC oder mehr pro Milliliter Blut in Zukunft am Steuer eines Fahrzeuges erwischt wird, handelt ordnungswidrig. Bis es zu einer Umsetzung dieses Grenzwertes durch ein Gesetz der Ampel-Koalition im Bundestag kommt und das Straßenverkehrsgesetz geändert wird, bleibt es vorerst beim generellen Verbot des Fahrens unter Cannabis-Einfluss.
Das Problem des Grenzwertes im Straßenverkehr
Fest steht: Der Grenzwert wird an Nanogramm THC pro Milliliter Blut bemessen. Doch dieser Wert bringt ein großes Problem mit sich. Bei regelmäßigem Konsum bleibt THC im Blut länger nachweisbar– auch wenn der letzte Konsum schon längere Zeit zurückliegt. So kann es dazu kommen, dass der Test positiv ausfällt, obwohl die Wirkung des Cannabis schon längst wieder nachgelassen hat. Dazu sagt Polizeirat Michael Fengler: “Grundsätzlich ist für uns vor Ort nicht feststellbar, ob eine Person (Cannabis) direkt vor Fahrtantritt konsumiert hat oder am Abend vorher. Oder möglicherweise auch eine Woche vorher, weil sie so viel nimmt, dass das noch so lange als Abbauprodukt feststellbar ist“. Eine Sanktionierung unabhängig davon, wann der Konsum stattgefunden hat – klingt erstmal unfair.
Kein Wunder also, dass auch auf Social-Media dieses Problem großes Aufsehen erregt hat. Viele User auf den Plattformen TikTok und Instagram sorgen sich um ihren Führerschein. Die geplante Regelung zum Grenzwert im Straßenverkehr sei unfair gegenüber denjenigen, die regelmäßig Kiffen und wegen eines positiven Tests sanktioniert werden, nur weil bei ihnen das THC im Blut noch länger nachgewiesen werden kann.
Doch die Meinungen gehen auseinander. So gibt es auch viele Stimmen, die die Regelung befürworten. „Wer regelmäßig kifft, hat nichts im Straßenverkehr verloren. Ganz einfach!“, schreibt ein User. Ähnlich spricht sich auch der ADAC dafür aus. Dieser bleibt weiterhin der Ansicht, dass Personen, die unter dem Einfluss von Cannabis stehen, generell nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollten. Begründend dafür führt dieser die Risiken des Konsums an. Der Konsum von Cannabis kann die Konzentration und die Aufmerksamkeit beeinträchtigen sowie die Reaktions- und Entscheidungszeit verlängern, was zu schwerwiegenden Folgen im Straßenverkehr führen kann.
Messverfahren der Polizei
Zudem fordert der ADAC die Prüfung zusätzlicher Messverfahren wie der Analyse von Mundhöhlenflüssigkeit um akute Beeinträchtigungen durch den Konsum zeitnah zu verwerten oder nachzuweisen.
Bislang geht die Polizei bei einer Verkehrskontrolle wie folgt vor: Es wird zuerst das Verhalten des Fahrers überprüft. Gibt es Anzeichen, wie rote Augen, erweiterte Pupillen oder Fahrfehler wie das Fahren von Schlangenlinien? Daraufhin kann durch einen Schnelltest THC oder das Abbauprodukt THC-COOH (THC-Carbonsäure) im Speichel, Schweiß oder Urin nachgewiesen werden. Sollte der Schnelltest positiv sein oder ein Verdacht bestehen und der Fahrer den Test verweigern, wird ein Bluttest durchgeführt. Denn nur der Nachweis von THC im Blutserum gilt als rechtsgültiger Beweis und wird in einem Labor analysiert.
Dauer der Nachweisbarkeit des THC
Wie lange kann THC nun letztendlich nachgewiesen werden? Und worin unterscheidet sich Cannabis von anderen Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bei denen der Promille-Wert zeitgleich mit der Wirkung nachlässt?
Auf die Frage, wie lange THC nun letztendlich nachgewiesen werden kann, kann man nur sagen, „es kommt darauf an“. Nämlich auf das Konsumverhalten des Einzelnen. Die Nachweisbarkeit von THC und seinem Abbauprodukt THC-COOH hängt also stark davon ab, wie viel und wie oft jemand Cannabis konsumiert. Es gibt lediglich grobe Richtwerte, die jedoch nur bedingt im Einzelfall anwendbar sind. Der ADAC führt dazu weiter aus: Beim Rauchen oder Inhalieren der Droge gelangt THC schnell ins Blut und erreicht innerhalb weniger Minuten seine Höchstkonzentration, die dann innerhalb von 45-60 Minuten stark abfällt. Bei gelegentlichem Konsum dauert es etwa sechs Stunden, bis die THC-Konzentration wieder unter den Grenzwert von 1,0 Nanogramm/Milliliter Blutserum fällt. Konsumiert jemand regelmäßig Cannabis, führt dies dazu, dass THC im Gewebe gespeichert wird und langsam ins Blut zurückgeführt wird, was Tage dauern kann. Dabei ist THC-COOH im Urin länger nachweisbar als im Blut, normalerweise 2-4 Tage bei gelegentlichem Konsum und 2-6 Wochen bei Dauerkonsum.
„Das Problem beim Cannabis ist (im Gegensatz zu anderen Drogen), dass sich dieser Cannabis-Wirkstoff THC im Körper anreichert. Das heißt, dass es sich in Muskeln und Fettgewebe ablagert und dort Depots aufbaut. Bei jemandem, der täglich oder auch täglich mehrmals konsumiert, reichert sich so viel in seinem Körper an, dass er dann aus diesen Speichern an das Blut wieder THC abgibt, auch in Phasen, wo er nicht konsumiert hat”, erklärt Rechtsmediziner Professor Stefan Tönnes.
Quellen: adac.de, mdr.de